Was Hiob heute zu sagen hätte
Der Leipziger Philosoph Christoph Türcke sucht in seinem Buch »Umsonst leiden« den Schlüssel zum Verstehen des Buches Hiob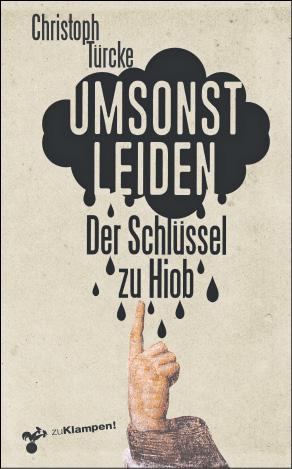
Die Hiobfigur ist als Inbegriff des leidenden Gerechten weltbekannt. Doch das biblische Buch Hiob steckt voller Rätsel. So stellt sich Christoph Türcke die Frage, warum es aus einer kleinen märchenhaften Rahmenhandlung und einer wortgewaltigen Dichtung besteht und gibt darauf eine verblüffende Antwort. Das Buch Hiob – so seine Grundthese – habe gegen den Weltschöpfer »als gnadenloses Äquivalenzprinzip« mit solcher Wucht aufbegehrt, dass es »das restaurierte nachexilische Judentum am Nerv traf«. Weil nicht sein kann, was dem Glaubenskanon im Weg steht, sei das Buch Hiob bearbeitet worden und zwar gleich mehrfach.
Als Quelle der Rahmenhandlung verortet Türcke ein Märchen. Dessen nichterhaltener dritter Teil habe nicht in das Weltbild des damaligen Judentums gepasst. Deshalb wurde es beschnitten, die monumentale Hiobsdichtung eingefügt und beide Teile von »Redaktoren« so bearbeitet, dass sie erst dadurch Eingang in den Tannach finden konnte. Im Folgenden analysiert Türcke das biblische Buch Hiob Kapitel für Kapitel, und stellt dabei fest, dass uns in der großen Dichtung (Hiob 3 bis 42,6) ein »um einhundertachtzig Grad gewendeter Hiob« präsentiert wird, der in heftigste Klagen gegen Gott ausbricht. Ohne eine erkennbare Gegenleistung (Äquivalent) wendet Jahwe Hiobs Geschick am Ende »umsonst«. Darin sieht der Autor den Versuch Jahwes, den durch den Satan provozierten »Testlauf [an Hiob] ungeschehen zu machen«.
Mit kriminalistischem Spürsinn geht Türcke auch der Frage nach, wer die verschiedenen Autoren und Bearbeiter der beiden Bücher waren und welche Motive sie dafür hatten. Im vorliegenden Ergebnis erfolge jedenfalls Hiobs »Wiederherstellung« durch Jahwe, weil er unschuldig sei. Einer der Redaktoren habe den Zorn Jahwes auf die drei Freunde umgelenkt, die im Märchen gar nicht vorkommen. Erst durch diese und andere entstellende Eingriffe habe das Buch Hiob überleben können. Einen Nachweis, ob das Hiobmärchen oder die Dichtung der älteste Text ist, hält Türcke nicht für möglich, anerkennt im Ergebnis aber, dass beide »durch Neurahmung einander zugehörig [wurden] und seither nicht aufhören, einander zu irritieren«.
Am Ende schlägt Christoph Türcke einen kurzen Bogen in die Gegenwart, von der er meint, dass das Äquivalenzprinzip sich hier selbst vergotte, wovon der expandierende Weltmarkt zeugt: »Er ist der faktisch anonyme Gott des Globalisierungszeitalters – der erste monotheistische, der nachweislich real existiert.« In dieser Welt – so seine Überzeugung – habe der biblische Hiob nicht leben wollen. »Zu Recht.«
Das alles trägt Christoph Türcke, emeritierter Philosophieprofessor, mit Verve und beeindruckenden Argumenten vor. Inwieweit man seinen Überlegungen folgen kann und will, mag jeder Leser für sich selbst entscheiden. Erfrischend zu lesen ist das Buch dank der recht unkonventionellen Schreibweise des Autors allemal, so dass »Umsonst leiden« zu einer interessanten Schlüssellektüre werden kann.
Impressionen vom Elbe-Tauffest
Impressionen vom Elbe-Kirchentag in Pirna
Festtag 100 Jahre Glaube + Heimat
Zum Vergrößern hier klicken.
Weitere Impressionen finden Sie hier.

























































































































































































