Wie der Glaube alles verändert
Auszug aus dem neuen Buch des Theologen Ulrich H. J. Körtner »Wahres Leben. Christsein auf evangelisch«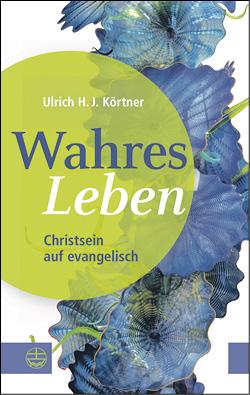
Der christliche Glaube ist nicht nur eine Möglichkeit neben anderen Optionen, sondern er ist der Sinn für das Mögliche. Wie es nämlich einen Wirklichkeitssinn gibt, so auch einen Möglichkeitssinn, ein Sensorium für Gott als Grund des Möglichen. Wer glaubt, dem ist mehr möglich, kann doch der Glaube, wie es im Neuen Testament heißt, sogar Berge versetzen (Matthäus 17,20). Uns werden von Gott neue Lebensmöglichkeiten zugespielt und Wege geöffnet, wo sich der Unglaube am Ende aller Wege angekommen sieht. Möglichkeiten, die wir uns nicht erarbeiten können, sondern die sich unverhofft auftun. Wer glaubt, leugnet keineswegs die Welt der Fakten, aber er lässt sich nicht von der vermeintlich unumstößlichen Macht des Faktischen in die Knie zwingen.
Recht verstanden ist der Glaube eine unmögliche Möglichkeit, weil er nur dort entsteht, wo ein Mensch von Gott als der alles bestimmenden Wirklichkeit der Liebe passiv ergriffen wird und sich ihm hingibt. Im Akt des Glaubens bekommt der Begriff der Wahl einen neuen, gegenläufigen Sinn: Nicht der Mensch wählt Gott, sondern dieser wählt ihn. Die Wahl des Glaubens besteht darin, von Gott erwählt und mit der Gabe des Glaubenkönnens und Glaubendürfens beschenkt zu werden. Das ist der Sinn der christlichen Er- wählungslehre, die in der reformierten Tradition eine besonders hervorgehobene Rolle spielt. (…)
Niemand gibt sich selbst das Leben, niemand bringt sich selbst auf die Welt. Unsere Vorstellung von einer selbstbestimmten Lebensführung ignoriert gern, dass unsere Autonomie und unsere Freiheit nur beschränkt und endlich sind. Unser Lebensweg wie auch die großen Entwicklungen und Ereignisse in der Welt sind doch nur in begrenztem Maße das ausschließliche Resultat menschlicher Planung und menschlicher Handlungen. Zwar unterscheiden wir Menschen uns von Tieren und Pflanzen dadurch, dass wir unser Leben nicht einfach leben, sondern bewusst führen müssen. Aber die eigene Lebensführung ist bei genauerer Betrachtung eben nicht das alleinige Resultat unseres Planens und Handelns, sondern auch durch Ereignisse bestimmt, die wir als schicksalhaft bezeichnen.
Wer im christlichen Sinne glaubt, erkennt in solchen Schicksalserfahrungen das Wirken Gottes. Wo andere Menschen von Zufall oder Kontingenz, vom Unglück oder vom Glück sprechen, das die eigenen Pläne begünstigen oder auch zunichte machen kann, wissen sich glaubende Men- schen auf verborgene Weise von Gott geführt, so dass aus Zufall Fügung und aus Fügung Führung wird.
Unser Leben und unsere Lebensführung sind inmitten aller Aktivität und planvoller Entscheidungen von einer grundlegenden Passivität bestimmt. Dazu gehört, dass wir geboren werden, und dazu gehört, dass wir sterben müssen. Auch der Rhythmus von Wachen und Schlafen ist ein Hin- weis auf die Grundpassivität unseres Daseins. Zu ihr gehören außerdem alle Widerfahrnisse und Zufälle. Selbst wenn wir aus guter Absicht handeln, haben wir doch die Folgen unseres Tuns nie völlig in der Hand. Wir können das Gute, das wir wollen, keineswegs immer in die Tat umsetzen. Das Handeln aus guter Absicht kann sogar böse Folgen nach sich ziehen. Ich kenne keinen dümmeren Spruch als den von Erich Kästner: »Es gibt nichts Gutes, außer man tut es«. Das Gute ist und bleibt vielmehr eine Gabe, die gläubige Menschen dankbar auf Gott als Quelle weltumspannender Güte zurückführen.
Das gilt auch für das persönliche Schicksal in Erfolg und Misserfolg, wie Dietrich Bonhoeffer seinem Freund Eberhard Bethge brieflich auseinandergesetzt hat: »Der Wunsch alles durch sich selbst sein zu wollen, ist ein falscher Stolz. Auch was man anderen verdankt, gehört eben zu einem und ist ein Stück des eigenen Lebens, und das Ausrechnenwollen, was man sich selbst ›verdient‹ hat und was man anderen verdankt, ist sicher nicht christlich und im übrigen ein aussichtsloses Unternehmen. Man ist eben mit dem, was man selbst ist und was man empfängt, ein Ganzes.« (…)
Wie das Leben ist auch der Glaube eine Gabe und keine menschliche Leistung. Glauben können, Vertrauen können, ist eine Gnade. Wissen kann man erwerben, aber den Glauben kann man ebenso wenig erzwingen wie die Liebe. Im modernen Universitätsbetrieb werden Wissensbilanzen aufgestellt, und Wissen wird als Produkt, als Leistung begriffen, die von Einzelnen oder im Kollektiv erbracht und sogar in Geldwert umgerechnet werden kann. Das Wissen und die Gewissheit des Glaubens sind keine Leistung dieser Art. Vertrauen entsteht nicht nur durch einen bloßen Entschluss des eigenen Willens. Es muss sich von allein einstellen und wachsen. Ob es gerechtfertigt ist oder enttäuscht wird, habe ich nicht in der Hand. Vertrauen bleibt ein Wagnis, getragen von einer Gewissheit, die nicht mit Sicherheit verwechselt werden kann. Auch wenn im Kreditwesen und im Geschäftsleben Garantien gefordert werden, gibt es im Letzten für Vertrauen keine Garantie.
Gott im Leben wie im Sterben zu vertrauen, bleibt auch deshalb eine unverfügbare Gabe, weil wir Menschen von Haus aus zu diesem Vertrauen gar nicht bereit sind, sondern uns lieber auf uns selbst verlassen und das eigene Dasein durch unsere Lebensleistung rechtfertigen wollen. Glauben können heißt demgegenüber, nicht länger aus sich selbst etwas machen zu müssen, um bei Gott und den Menschen Anerkennung zu finden. Es bedeutet, von der Angst vor der eigenen Bedeutungslosigkeit befreit zu werden. Paulus und die Reformatoren sprechen in diesem Zusammenhang von der Rechtfertigung des Menschen allein durch den Glauben.
In einer Betrachtung zum Weihnachtsfest 1953 schrieb der evangelische Theologe Rudolf Bultmann: »Wir sind nicht die, die wir zu sein scheinen, zu sein meinen. Wir sind die, die wir im Lichte Gottes sind. Wir sind, was wir hier und jetzt nie sind, aber das, was wir hier und jetzt nie sind, gerade das ist unser eigentliches Sein.« Das aber heißt doch: Mein Selbstwert und meine Würde hängen nicht von dem ab, wie andere mich sehen und beurteilen, auch nicht da- von, wie ich mich selbst sehe und beurteile, sondern einzig und allein davon, wie Gott mich sieht und beurteilt. Und nicht ich bin es, der mein Leben zu einer Ganzheit vollendet, sondern Gott – durch alle Brüche und Unvollkommenheiten meines Lebens hindurch.
Auszug aus: Ulrich H. J. Körtner: Wahres Leben. Christsein auf evangelisch. Evangelische Verlagsanstalt Leipzig 2021, 134 S., 12 Euro.
Impressionen vom Elbe-Tauffest
Impressionen vom Elbe-Kirchentag in Pirna
Festtag 100 Jahre Glaube + Heimat
Zum Vergrößern hier klicken.
Weitere Impressionen finden Sie hier.


























































































































































































