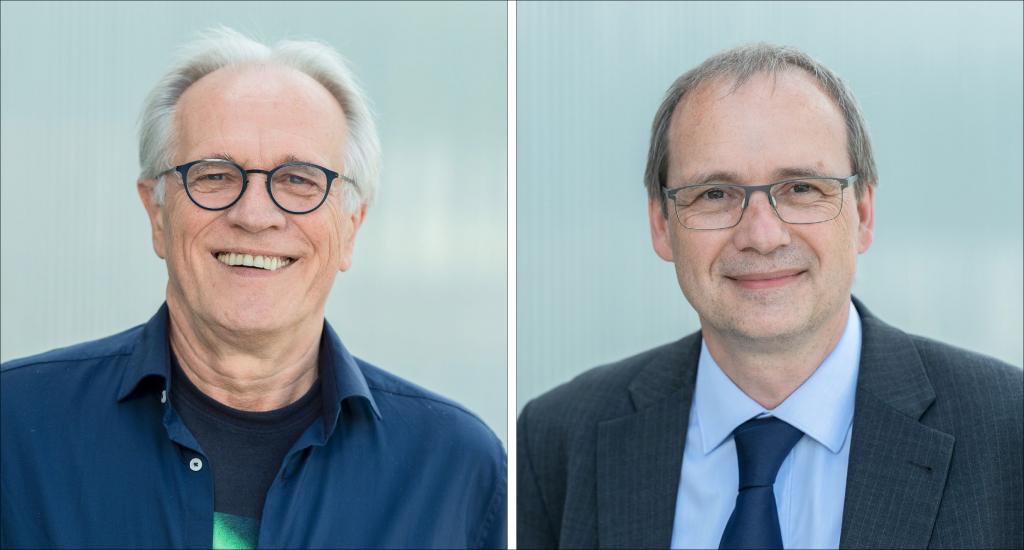Gesicht zeigen, Gespräch suchen
Kirche und Demokratie: In der Kirche wächst die Sorge vor zunehmendem Rechtsextremismus. Im Erzgebirge informierten Experten über Hintergründe und wie Brücken gebaut werden könnten.Worte wie »Überfremdung« und »Lügenpresse« hört Franz Volkmar Ludwig häufig. »Vor allem auf Arbeit in der Grundschule, aber auch in meiner Kirchgemeinde«, sagt der Chemnitzer. Seine Tochter lebe mit einem Mann aus Kenia zusammen, erzählt er. Das habe den Kirchvorsteher sensibel gemacht, was den Umgang mit Fremden angeht. Wenn ihm solche Reizworte wie »Überfremdung« begegnen, wolle er mit den Menschen darüber reden, sagt er. Mit seiner St.-Andreas-Gemeinde will er ein Forum im Stadtteil etablieren, um wieder miteinander ins Gespräch zu kommen.
Auf diese oder andere Weise haben alle Teilnehmer des Fachtages »Rechtspopulismus in christlichen Kreisen« in Hartenstein schon mit Rechtspopulismus oder -extremismus ihre Erfahrungen gemacht. Das zeigt sich in einer kurzen Umfrage unter den gut 30 Männern und Frauen, die vor allem aus Chemnitz und dem Erzgebirge einen Tag vor den Kommunalwahlen zum Fachtag gekommen sind. Im neuen evangelisch-freikirchlichen Gemeindezentrum »Kirche für Dich« erzählt eine Kirchvorsteherin aus Schwarzenberg-Neuwelt von den schwierigen Diskussionen in der Kirchgemeinde über eine Flüchtlingsunterkunft und die Hilfe für Geflüchtete. Eine Kirchvorsteherin aus Schneeberg berichtet von den Demonstrationen und Anfeindungen gegen die Erstaufnahme-Einrichtung in der Stadt. »Eine bedrückende Situation«, findet sie. Die Geflüchteten aus der Ukraine hätten manche Menschen aber auch umdenken lassen, hieß es.
Dass derart ausgrenzende Worte und Haltungen nicht mehr konservativ sind, machen die Referenten zum Fachtag schnell klar. Besonders Rechtsanwältin und Publizistin Liane Bednarz, die sich selbst als liberal-konservativ bezeichnet, erklärt dabei viele Begriffe, Personen und Entwicklungen. Die Autorin des Buches »Die Angstprediger – Wie rechte Christen Gesellschaft und Kirche unterwandern« erzählte auch von ihren Erfahrungen bei einem Vortrag in Freiberg. »Ich habe noch nie so viel Hass erlebt.«
Hörfunkjournalist und Autor Andreas Malessa sagt mit Blick auf biblische Überlieferungen von Mose und anderen: »Gegen Schutzsuchende zu hetzen ist eine Verleugnung unserer Kirchengeschichte.« Er analysierte Forderungen der AfD und zeigte mit verschiedenen Beispielen warnend, wie das evangelikale Magazin idea-Spektrum verständnisvoll Pegida oder Ausländerfeindlichkeit in den 1990er Jahren kommentierte. »Ich wünsche Ihnen die Gabe der Geistesunterscheidung«, sagt er den Zuhörern zur Frage, wo rote Linien gezogen werden sollten.
Auch Superintendent Dieter Bankmann aus Aue kennt die fremdenfeindlichen Anwürfe von rechts: Als bei einer Weihnachtsfeier 2019 in einem Pfarrhaus in Aue ein ein Syrer mit einem Messer einen Helfer schwer verletzte. Nicht zuletzt erlebte die ganze Landeskirche Sachsens ab Herbst 2019 eine heftige Diskussion über die Unterscheidung konservativer und rechtsextremer, demokratiefeindlicher Einstellungen, ausgelöst durch die Schriften des früheren Landesbischofs Carsten Rentzing aus seiner Studentenzeit. Die daraufhin von der Kirchenleitung eingesetzte »Spurgruppe« gab zwar einen Bericht ab, zog die Verfassungstreue und gegenseitige Achtung als rote Linie. Einen Gesprächsprozess in den Kirchgemeinden hatte das aber nicht wirklich zur Folge.
Der Fachtag könnte allerdings ein Impuls dafür sein, hofft Michael Beyerlein, der ihn maßgeblich mit vorbereitet hat. Der kirchliche Beauftragte für Integrations- und Migrationsfragen im Erzgebirge und Vogtland könnte sich dieses Format auch in anderen Regionen vorstellen. Einen wichtigen Grund für den Fachtag gerade im Erzgebirge hatten die Veranstalter in ihrer Einladung schon beschrieben: »Uns erschüttert, dass in unserem schönen Erzgebirge mit den ›Freien Sachsen‹ eine neue rechtsextreme Partei gegründet wurde«, hieß es vom Kirchenbezirk Aue, der Diakonie Erzgebirge sowie dem Kompetenzzentrum für Gemeinwesenarbeit und Engagement (KGE). Sie zeigten sich zudem »besorgt, dass viele Menschen, die wir nicht als rechtsextrem einschätzen, bei Demonstrationen und Kundgebungen keinen Abstand mehr zu Funktionsträgern solcher Parteien halten, sowohl räumlich als auch inhaltlich«. Das konnten viele der Teilnehmer am Fachtag bestätigen. Ein Chemnitzer erzählt, dass Martin Kohlmann als Vorsitzender der »Freien Sachsen« zu seiner früheren Kirchgemeinde gehöre, andere Kirchvorsteher aus dem Erzgebirge beklagen die Spaltung der Gemeinden durch unterschiedliche Einstellungen zur Corona-Pandemie, berichten von Verschwörungstheorien bis in tiefste christliche Kreise. »Was Gruppen radikalisiert, ist der Kontaktabbruch«, sagt Harald Lamprecht dazu. Der Beauftragte der Landeskirche Sachsens für Weltanschauungsfragen beobachte auch bei sich selbst, dass er bei Corona-Gesprächen intolerant geworden sei: Wenn alles Gesagte falsch sei, dann höre er auf zu diskutieren, meint Lamprecht.
Dass das Gespräch verbindet und Ziel sein müsse, darüber herrscht Einigkeit beim Fachtag. Ob das Gespräch auch mit Politikern extremistischer Parteien zu führen ist, war unter Teilnehmern jedoch umstritten. Die Freie Presse hatte bei einem Wahlforum in Annaberg-Buchholz jüngst einen Kandidaten für die Landratswahl ausgeschlossen, Stefan Hartung von den »Freien Sachsen«. »Das ist nicht gut«, meint Kirchvorsteher Franz Volkmar Ludwig. »Das erzeugt nur Märtyrer«, erinnert er an Bilder von Hartung mit vielen Anhängern vor dem Wahlforum.
Anders hatte es Pfarrer Wolfram Rohloff in Marienberg gemacht. Er lud alle Kandidaten für die Landratswahl im Erzgebirgskreis ein, auch Stefan Hartung. Das habe auch für Kritik gesorgt, sagt der Zöblitzer Pfarrer dem SONNTAG. Er würde nicht grundsätzlich dazu raten, Politiker extremer Parteien einzuladen. »Einerseits ist es Werbung für sie, andererseits sollten wir miteinander reden«, sagt Rohloff.
Er habe sich gut auf die Diskussion mit den Politikern vorbereitet und besondere Punkte aus deren Wahlprogrammen gesucht: Bei den »Freien Sachsen« etwa zur »geordneten Rücksiedelung der Westdeutschen« oder zur Unabhängigkeit Sachsens, nennt er zwei Beispiele. Zudem habe er der Diskussion ein Bibelwort über die innere Reinheit vorangestellt. »Es sollte an dem Abend deutlich geworden sein, was hinter dem Wahlprogramm steht«, zeigt sich der Pfarrer zufrieden.
Die Referenten erhoffen sich das auch von dem Fachtag in Hartenstein. »Wir sollten wissen, woher die Gedanken kommen, um Brücken zu bauen«, meint Harald Lamprecht. »Wenn wir die Kultur der Dankbarkeit stärker pflegen, dann hilft das auch gegen Pegida und andere Gruppen.« Für Ruben Meyer, Vorstand der Diakonie Erzgebirge, ist das Verbindende ganz wichtig. Durch Corona und die Debatte um die Impfpflicht seien die Teams in den Diakonie-Einrichtungen teilweise zerstritten, die Meinungen sehr verschieden. Der Fachtag ist für ihn tatsächlich nur ein Auftakt. Zusammen mit dem KGE sei ein dreijähriges Projekt zur Demokratieförderung geplant.
Impressionen vom Elbe-Tauffest
Impressionen vom Elbe-Kirchentag in Pirna
Festtag 100 Jahre Glaube + Heimat
Zum Vergrößern hier klicken.
Weitere Impressionen finden Sie hier.